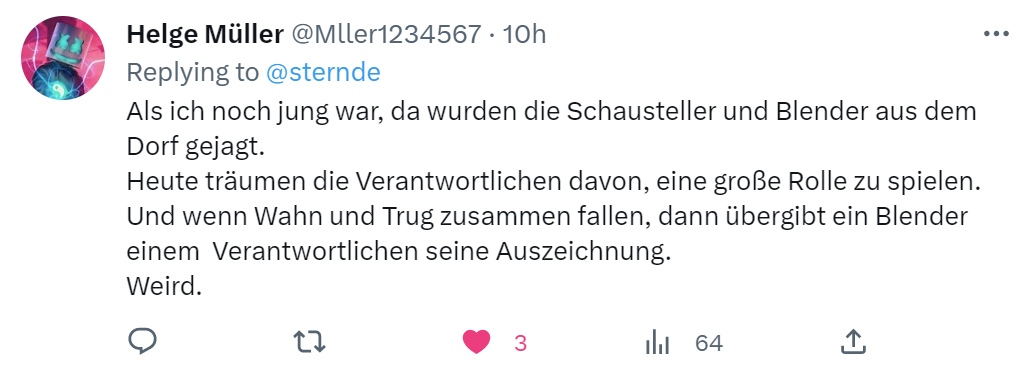Sean Penn hat mit seiner Doku „Superpower“ einen Film über die Ukraine, den Krieg gegen das Land und Wolodymyr Selenskyj gedreht. Es ist eine Liebeserklärung – mit einem unangenehmen Beigeschmack.
Ganz am Ende hat man dann doch kurz Angst um das Leben von Sean Penn. Der 62-jährige Schauspieler und Regisseur aus Kalifornien, Ex-Mann von Madonna und doppelt Oscar-gekrönt für seine Leistungen in „Mystic River“ und „Milk“, hat sich tatsächlich an die Front gewagt, irgendwo in der Nähe von Bachmut in der Ostukraine. Nur knapp 100 Meter entfernt lauern die Russen auf ihre Chance, einen Fluss zu überqueren, ein Trupp ukrainischer Soldaten hält dagegen. „Dieser Krieg ist für mich erst zu Ende, wenn mein Heimatdorf befreit ist und ich zurück kann“, sagt der Anführer. Penn bedankt sich artig, lobt die Tapferkeit, mit der die Ukrainer auch den Rest der Welt vor der Tyrannei verteidigen und zieht wieder ab. Genug gesehen, genug gewagt.
Man kann „Superpower“, der fast zwei Stunden langen Doku von Penn, einiges vorwerfen. Dramaturgisch, ästhetisch und auch inhaltlich. Trotzdem gelingen ihm und seinem Team immer wieder Momente, die mehr vermitteln als die üblichen Nachrichtensendungen und Zeitungsberichte. Weil ein waschechter Hollywood-Star, der durch Ruinen, Schützengräben und über Schlachtfelder stapft, automatisch mehr Blicke auf sich zieht als die meisten anderen Kriegsreporter und Fotografen.
Eigentlich sollte Penns Film ein amüsant staunendes Porträt werden über Wolodymyr Selesnkyj. Ein politisches Leichtgewicht, das in der Ukraine und auch in Russland vor allem als Held von albernen Komödien und sexistischen Gags viele Fans hatte. Nach den Euromaidan-Protesten und Neuwahlen war er plötzlich Präsident, auch weil er versprach, ein Mann des Volkes zu bleiben und endlich die korrupten Eliten auszumisten.
Genug Stoff also für eine männliche Aschenputtel-Geschichte und der besten Verschmelzung von Showbiz und echter Macht seit Ronald Reagan. Doch dann brach der Krieg aus und Penn hatte das Glück, oder Unglück, seine Termine in Kiew genau zu dem Zeitpunkt zu absolvieren, als die ersten russischen Bomben fielen vor fast genau einem Jahr. Es folgen hektische Kamerafahrten, viel Gerenne, Schutzräume und Explosionen am Horizont.
Sechs Mal war Penn angeblich insgesamt für seinen Dreh in der Ukraine, doch wer sich von „Superpower“ neue Einsichten und persönliche Anekdoten über den neuen Superhelden der internationalen Politik erhofft hatte, wird trotz mehrerer Interviews eher enttäuscht. Penns Films ist weniger ein Selenskyj-Porträt oder Kriegsfilm, als eine Liebeserklärung an ein noch immer sehr junges Land und seine tapferen Bewohner. Er nimmt die Zuschauer huckepack auf seine Trips mit, spricht mit vielen einheimischen und amerikanischen Experten und erklärt wie ein Reiseführer die historischen Hintergründe des Konflikts.
Leider bekommt durch Penns Dauerpräsenz in fast allen Szenen „Superpower“ einen unangenehmen Beigeschmack und wirkt teilweise wie ein Eitelkeitsprojekt.
…
Wie nah sich Hollywood und der Krieg gegen die Russen annähern können, zeigt eine besonders symbolträchtige Szene. Zurück in den USA trifft Penn zwei Kampfjet-Piloten, die nur unter ihren Spitznamen Juice und Moonfish auftreten. Ersterer sieht selbst aus wie ein jugendlicher Serienstar, fordert die Welt auf, den Ukrainern endlich bessere Düsenjäger zur Verfügung zu stellen und schildert, wie er und seine Truppe Kiew weiterhin von oben beschützen. Anschließend schleppt Penn die beiden ins Kino, ausgerechnet in „Top Gun: Maverick“. Danach verbindet er Juice mit dem Piloten-Darsteller Miles Teller, per Videoanruf werden Nettigkeiten ausgetauscht.
Zur Pressekonferenz auf der Berlinale, wo der Film gerade seine Weltpremiere hatte, erscheint Penn in einer schwarzen Outdoor-Jacke, sein Basecap mit Camouflage-Muster tief in die Stirn gezogen. Gefragt nach dem Sinn des Schriftzugs „Killer Tacos“ antwortet er lapidar: „Falls Sie mal in den Norden von Hawaii kommen: In diesem Laden gibt es die besten Tacos.“ Danach beschimpft er Putin als „kleinen, gruseligen Brutalo“, ihn auch zu treffen und zu sprechen, interessiere ihn nicht. „Putin hat schon viel zu viel gesagt. Da kommt nur Lug und Trug. Genauso gut könnte ich mit einer Wand reden.“
Einer seiner Oscars steht inzwischen tatsächlich im Büro von Selenskyj, als Anerkennung seines Mutes und seines Freiheitskampfes. Der Präsident könne ihn aber jederzeit einschmelzen, wenn er das Material brauche. Ihn zu treffen, am ersten Tag des Krieges, nicht wie geplant im Anzug, sondern in einem Militär-Outfit, sei für ihn ebenso einschneidend gewesen wie die Geburt seiner Kinder, sagt Penn und seine Augen werden kurz feucht. „Ich empfinde mehr Zuneigung für Selenskyj denn je.“
-
Neueste Beiträge
April 2025 M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Archive
- März 2025
- Februar 2025
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Januar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- April 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014